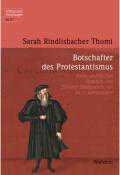Die Autorin führt den Leser gleich in zwei «dunkle» historiographische Räume: ins 17. Jahrhundert und zur Rolle der einflussreichen reformiert-orthodoxen Geistlichkeit in Zürich. Auch wenn in den letzten Jahren zahlreiche Studien über das 17. Jahrhundert, unter anderem aus der Feder von André Holenstein, dem Betreuer der hier zu besprechenden Arbeit, erschienen sind, gilt dieses immer noch als «saeculum obscurum». Zwischen den heroischen Jahren der Reformation und dem Aufbruch ins lichte Zeitalter der Aufklärung zwängt sich das düstere Saeculum der gewalttätigen Gegenreformation, der engstirnigen protestantischen Orthodoxie und der blutigen Glaubenskriege. Zwar ist durch die Arbeiten von Thomas Maissen und Thomas Lau bekannt, dass die Zürcher Geistlichkeit einen grossen Einfluss auf die innen- und aussenpolitischen «Standesgeschäfte» besass. Schon 1651 beklagte der katholische Luzerner Ratsherr Ludwig Pfyffer, dass die Zürcher Prädikanten als «Hitzköpfe» und «Lärmenblaser» die «Haubtursach» der konfessionellen Konflikte und «aller eidgnössischer zwietrachen, empörungen und kriegsgefahren» seien. Sarah Rindlisbachers Arbeit bringt nun in ihrer umfangreichen Berner Dissertation Klarheit.
Die zeitliche Einschränkung auf das 17. Jahrhundert ist durch zwei fundamentale Wandlungen in den Zürcher Aussenbeziehungen vorgegeben. Im 16. Jahrhundert pflegte Zürich unter dem Einfluss von Zwingli und seiner Nachfolger einen ausgeprägten Isolationismus. Als aber in der zweiten Jahrhunderthälfte der Katholizismus nach dem Konzil von Trient erstarkte und im Rahmen der Gegenreformation – auch gewalttätig – gegen den Protestantismus vorging, etwa in der Bartolomäusnacht von 1572 und in der Genfer Escalade von 1602, ergriffen Einkreisungs- und Untergangsängste die reformierte Schweiz. In den 1610er Jahren gab Zürich die selbst gewählte Isolation auf und reaktivierte die Pflege der Aussenbeziehungen und die Bündnispolitik. Das Ende dieser Phase wird markiert durch die «Säkularisierung des politischen Bereichs» (S. 523) zu Beginn es 18. Jahrhunderts. Der Einfluss der Geistlichen auf die Politik wurde eingeschränkt. Der Rat begann sich nun in kirchliche Bereiche einzumischen. Die Verfasserin weist daher zurecht darauf hin, dass das Ende der Konfessionalisierung in der Schweiz nicht wie in Deutschland auf 1648, sondern auf 1712 anzusetzen sei.
Die Autorin stellt die aussenpolitische Aktivität von sechs Geistlichen, drei Theologieprofessoren und drei Vorstehern der Zürcher Kirche (Antistites), die alle aus dem Stadtzürcher Bürgertum stammten, anhand von sechs Schlüsselereignissen ins Zentrum ihrer Untersuchung: dem Ende der aussenpolitischen Abstinenz (1612–1618) und der Abordnung einer Zürcher Delegation an die Synode von Dordrecht, dem schwedischen Abenteuer (1631–1634), dem Projekt einer Allianz mit Oliver Cromwell (1653–1656), dem Wigoltinger Handel (1664/65), dem Einsatz der Schweizer Soldtruppen im Niederländisch-Französischen Krieg (1672–1678) und Zürichs Rolle im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688–1697). Sie zeichnet quellenbasiert nach, wie die sechs Geistlichen ihr «Wächteramt» gegenüber dem Zürcher Rat wahrnahmen und sich zu einflussreichen aussenpolitischen Beratern entwickelten. Da der Staat Zürich über keinen diplomatischen Dienst verfügte, übernahmen sie informell diese Aufgabe.
Durch ihre Ausbildung an reformierten Hochschulen sowie ihre Korrespondenz mit ihren Theologenkollegen vor allem im Reich, in den Niederlanden, in England und Frankreich hatten die Geistlichen ein transnationales Netzwerk aufgebaut. Damit positionierten sie die Limmatstadt als einen zentralen Knoten in der «calvinistischen Internationale». Die Verfasserin zeigt auf, wie sich die transnationale Kommunikation und die zentralen interpersonalen Bindungen gestalteten, wie sich die Geistlichen in den Dienst der protestantischen Gesandten und des Zürcher Rats stellten, der meistens, aber nicht immer ihren Ratschlägen folgte, wie sie von Zürich aus Diplomatie betrieben («Heimdiplomatie») und welche persönlichen und familialen Interessen sie verfolgten. Innovativ ist das Kapitel über die «Sprache des politischen Protestantismus», in der die Zürcher Kirche und die Gemeinschaft der europäischen Reformierten als «Gemeinschaft der Heiligen» und «Wahre Kirche Gottes» dargestellt wird, die sich scharf von den verhassten Katholiken, aber auch von der lutherischen Schwesterkirche und «Abweichlern» innerhalb des Calvinismus abgrenzte. In dieser religiös verengten Weltsicht gab es keinen Platz für irenische Strömungen, auch nicht innerprotestantisch.
Die Autorin weist zurecht darauf hin, dass Zürich und deren reformierte Geistlichkeit die treibenden Kräfte in den Konflikten mit den katholischen Orten waren. Trotzdem zeichnet sie ein weiches Bild von Antistes Johann Jakob Breitinger, der schon 1614 behauptete, dass die katholischen Miteidgenossen «leyder unsere grösten Feynd» seien. Auch wenn das Handeln der geistlichen Akteure aus ihrer Zeit und ihrem Wertehorizont zu verstehen ist, kann die harte Kritik etwa des Zürcher Staatsarchivars Paul Schweizer und von Emil Usteri nicht einfach als anachronistische oder nationalistische Kritik abgekanzelt werden. Antistes Breitinger war zusammen mit seiner Faktion Kriegstreiber, der 1633/34 Zürich und die anderen reformierten Orte zum Kriegseintritt an der Seite des Schwedenkönigs gegen die katholischen Miteidgenossen drängte – eine Episode, welche in der Zürcher Historiographie eher diskret behandelt wird. Dies hätte wohl die Sprengung des Corpus Helveticum, sicher das Ende der Neutralität bedeutet. Der publizistische Hass auf die Katholiken, aber fast noch mehr auf die zürcherische Friedens- bzw. Neutralistenpartei um Bürgermeister Johann Heinrich Holzhalb war grenzenlos. Aber schliesslich siegten die «abscheulichen Neutralisten» und Breitinger wurde auf sein geistliches Amt verpflichtet.
Die Verfasserin legt eine wichtige Studie vor, die man mit Gewinn liest, aber auch viele neue Fragen aufwirft. Welche Rolle spielten die geistlichen Ratgeber in innereidgenössischen Fragen, z. B. bei der Instruktion der Zürcher Tagsatzungsgesandten? Der kurze Hinweis der Verfasserin, wonach der grosse Einfluss der Zürcher Theologen am ehesten mit Genf zu vergleichen ist, wohingegen deren Einfluss in Bern, Basel und Schaffhausen gering gewesen sei, ruft geradezu nach einer vergleichenden Studie. Und in den katholischen Kantonen? Da wären vor allem die Weltgeistlichen an der Spitze der einzelörtischen Kirchen zu untersuchen, etwa die Dekane und vor allem die bischöflichen Kommissare, die ebenfalls Zugang zu den Räten hatten. Die Verfasserin hat mit ihrer Arbeit ein breites Forschungsfeld eröffnet und dafür sei ihr gedankt.
Zitierweise:
Jorio, Marco: Rezension zu: Rindlisbacher Thomi, Sarah: Botschafter des Protestantismus. Außenpolitisches Handeln von Zürcher Stadtgeistlichen im 17. Jahrhundert. Göttingen 2022. Zuerst erschienen in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 74(1), 2024, S. 125-126. Online: <https://10.24894/2296–6013.00142>.