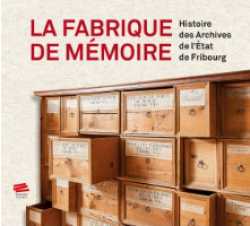Mit dieser (ge‐)wichtigen, reich illustrierten und sorgfältig gestalteten Publikation beschert sich das Staatsarchiv Freiburg selbst. Es handelt sich zum einen um eine spezifisch schweizerische Archivgeschichte, die im ersten Teil des Bandes chronologisch nachgezeichnet wird und in der sich – bezogen auf den Standort Freiburg – die historischen Brüche und Verwerfungen, aber auch die Kontinuitäten in der Schweizer Geschichte seit dem späteren Mittelalter mehr oder minder direkt widerspiegeln. Zum anderen geht es auch um eine Personengeschichte, waren es doch die im zweiten Teil porträtierten Männer sowie eine Frau, die das Freiburger Archiv bis in die späten 1960er-Jahre hüteten und erschlossen und so erst zu einer funktionierenden «Datenkapsel» machten, welche die Zeiten überdauert hat. Und zu guter Letzt trägt die Publikation die Züge einer allgemeinen Archivgeschichte, war doch die Freiburger Institution mit Herausforderungen und Problemen konfrontiert, die wohl alle Einrichtungen dieser Art kennen: knappe personelle Ausstattung, zum Teil bauliche Mängel (Kälte, Feuchtigkeit, Feuergefahr) und vor allem chronischer Platzmangel, der in der Bestimmung von Archiven selbst begründet ist. In seinem Fazit, das gleichzeitig auch als Ausblick dient, spricht Lionel Dorthe noch eine weitere, zunehmend dringlichere Herausforderung an, nämlich die Sicherung digitaler Daten.
Im ersten von insgesamt einundzwanzig Kurzkapiteln geht Kathrin Utz Tremp den Ursprüngen der Freiburger Archive nach und verortet diese in der städtischen Kanzlei. Seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert liegen Listen vor, auf denen die Kanzler namentlich verzeichnet sind; etwas älter sind die ersten erhaltenen Beispiele städtischen Schrifttums, so das erste Bürgerbuch mit Einträgen ab 1341 oder die erste Freiburger Gesetzessammlung (ab 1363). Einen markanten «Verschriftlichungsschub» macht die Verfasserin dann gegen Ende des 15. Jahrhunderts aus, nach der Aufnahme Freiburgs in die Eidgenossenschaft (1481). Administration, Politik und Schriftlichkeit gehen Hand in Hand und legen den Grundstein für das städtische Archivwesen.
Eine prägende Figur der Freiburger Archiventwicklung im ausgehenden 16. Jahrhundert war der von Leonardo Broillet vorgestellte Kanzler Wilhelm Techtermann. Während der vierzehn Jahre, in denen er für die Kanzlei verantwortlich war, sorgte er für bauliche Anpassungen und bestellte eigens Mobiliar («trucken») für die sachgemässe Aufbewahrung von Urkunden. Weitere Tätigkeitsfelder Techtermanns betrafen unter anderem die Inventarisierung, Einordnung und Duplizierung städtischer Titel und Privilege, deren Wert ihm als Kanzler besonders bewusst war. Zur sichereren Aufbewahrung der kostbaren Dokumente liess er eigens Ledersäcke anfertigen, zum Schutz der Siegel auch Kapseln aus Holz und aus Messing. Im 17. Jahrhundert scheint dann der von Techtermann initiierte Innovationsschub etwas an Schwung verloren zu haben.
1747 kam es zu einer von Rita Binz-Wohlhauser beschriebenen Reorganisation, in deren Folge zwei Archivaren-Stellen geschaffen wurden, die dem Kanzler und dessen Vertreter, dem Ratsschreiber, unterstellt waren. Grund für diese personelle Aufstockung war die Unzufriedenheit mit dem Zustand des überlieferten städtischen Schrifttums. So sollten die Ratsmanuale durch Repertorien erschlossen und die städtische Korrespondenz in neuen «kästen» geordnet werden. Die Archivare stammten aus der ratsfähigen Bürgerschaft und nutzten ihren Posten als Zwischenstation auf dem Weg zu höheren Weihen.
Die Helvetische Republik brachte der Eidgenossenschaft eine politische und auch archivalische Zäsur, wie Alexandre Dafflon, der amtierende Freiburger Staatsarchivar, in seinem Beitrag ausführt. Die – wie sich herausstellen sollte – kurzlebigen Zentralisierungsbestrebungen in der Helvetik äusserten sich nicht zuletzt auch darin, dass das Direktorium die Aufsicht über die Kantons- und Gemeindearchive übernehmen wollte – ein Vorhaben, das mangels Ressourcen und Zeit letztlich scheiterte. Das «Erbe» dieses unruhigen Abschnitts war der «erbärmliche Zustand» («état pitoyable»), in dem sich das freiburgische Staatsarchiv seit dem Ende des Ancien Régime befand. Die Mediationszeit sah deshalb ein ambitioniertes Inventarisierungsprogramm vor, das sowohl das Kanzlei- als auch (neu) die Kommissariatsarchive umfasste, d. h. die Archive der freiburgischen Grundherrschaften, wobei beide Bestände aus Sparsamkeitsüberlegungen einer einzigen Person übertragen wurden. Das Ergebnis war ernüchternd: «Malgré le discours très volontariste des autorités, les Archives vont bientôt être paralysées à la suite d’une succession d’incidents» (S. 125).
1843 wurden die beiden genannten Bestände formell vereint und dem Generalkommissariat überantwortet, bevor sie fünf Jahre später, nach der Niederlage im Sonderbundskrieg und im Zuge der von der neuen Kantonsregierung eingeleiteten Reorganisationen, (wieder) der Kanzlei übertragen wurden. In den nachfolgenden Jahrzehnten kam es zu weiteren Zusammenlegungen: Im Nachgang zum Gesetz zur Ablösung der Grundlasten («rachat des redevances féodales») im Jahr 1838 gelangten die obsolet gewordenen Pläne und Lehensanerkennungsakten in die Kommissariatsarchive, und 1863 wurden die Notariatsarchive dem zentralen Archiv einverleibt, was jedoch die endemischen Platznöte weiter verschärfte. So waren die Bestände bereits 1799 in drei Archivdepots (darunter die Kanzlei) eingelagert, deren Ordnung höchst unterschiedlich beurteilt wurde. Das 19. Jahrhundert war denn auch durch die Suche nach neuen Räumlichkeiten geprägt. Wir überspringen hier die Zwischenstandorte und erwähnen nur den bislang vorletzten Archivstandort, nämlich das im Auquartier gelegene ehemalige Kloster der Augustinereremiten, wohin die Archive 1918 umzogen. Dieser Standort war indes nicht ideal, Feuergefahr und Feuchtigkeit waren wiederkehrende Sorgen, zu denen anfangs der 1960er-Jahre das wiederkehrende Platzproblem kam. Der jüngste Standort wurde im Sommer 2003/ Winter 2004 bezogen, nämlich das in Bahnhofsnähe gelegene Gebäude der «Industrielle», einer ehemaligen Kartonagen-Fabrik – eine Lösung, die aufgrund der beschränkten Platzkapazität keine endgültige sein wird…
Die chronologisch durchlaufende Archivgeschichte wird durch eine zwölfteilige, die Zeit zwischen 1800 und 1968 abdeckende «Porträtgalerie» ergänzt, die elf Archivaren und einer Archivarin zugedacht ist, von denen die meisten, aber nicht alle als Staatsarchivare amteten. Der Hintergrund des ersten berücksichtigten Archivars, Jean-François Uffleger, ist hinsichtlich seiner sozialen Herkunft und seiner auf Verwaltungsbelange ausgerichteten Vorbildung beispielhaft, und dies bis in die Zeit der Restauration. Uffleger entstammte einem ratsfähigen Geschlecht, sein Urgrossvater, Grossvater und Vater waren alle Freiburger Ratsherren. Nach Rechtsstudien in Strassburg trat Jean-François 1789 selbst in den Rat der Zweihundert ein und bekleidete in der Folge verschiedene Verwaltungsämter. Die Sozialisierung im Ancien Régime und eine konservative Grundhaltung hinderten ihn nicht, in der kurzen Zeitspanne der Helvetik öffentliche Verwaltungsämter auszuüben, so ab 1800 dasjenige des Archivars des neu begründeten Kantons Freiburg. Abgesehen von einem Unterbruch zwischen 1802 und 1804, übte er dieses Amt auch in der Mediationszeit (bis 1814) aus. Die Laufbahn seines Nachfolgers Rodolphe de Weck, wiewohl dieser nur ein Jahr lang Archivverantwortlicher (1814–1815) war, ist insofern paradigmatisch, als zu seinem Hintergrund eine Offiziersausbildung gehörte und er 1811 als Ufflegers Adjunkt ins Archiv eintrat – zwei Muster, die sich wiederholen sollten, Letzteres bis in die jüngere Vergangenheit. Mit Jean Jacques Alexandre Stutz tritt 1822 der Sohn eines Wirtes an die Spitze des Archivs, der – ganz «klassisch» – Erfahrungen im Militär (als Offizier) sowie in der Verwaltung gesammelt hatte. Mit ihm verstetigte sich das Amt des Staatsarchivars insofern, als es in der Regel nicht mehr bloss als ein Karriereschritt unter anderen diente, sondern gleichsam eine «Lebensaufgabe», Krönung und Abschluss einer Laufbahn wurde. Weitere markante Gestalten waren Stutzs kurzzeitiger Vorgänger und langjähriger Nachfolger Joseph Victor Tobie de Daguet, Joseph Schneuwly, Tobie de Raemy, Georges Corpataux und Jeanne Niquille, die erste Freiburger Archivarin – wenn auch nie Staatsarchivarin – und gleichzeitig die erste promovierte Historikerin im Archivdienst (wobei die weibliche Form in diesem Fall auch die Männer einschliesst).
Was den chronologischen, institutionsbezogenen Teil des vorliegenden Werkes betrifft, so haben wir unser Fazit eingangs bereits vorweggenommen. Mit dem zweiten, auf die Personen im Archiv ausgerichteten Teil wird der Band um eine sozialgeschichtlichprosopographische Facette ergänzt, die ihn passend abrundet. Das einzige Bedauern betrifft das Fehlen eines (Personen‐)Registers.
Zitierweise:
Modestin, Georg: Rezension zu: Dafflon, Alexandre; Dorthe, Lionel; Blanc, François (Ltg.); Blanck, David (Mitarbeit): La fabrique de mémoire. Histoire des Archives de l’État de Fribourg, Neuchâtel 2021. Zuerst erschienen in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 74(1), 2024, S. 119-121. Online: <https://10.24894/2296–6013.00142>.