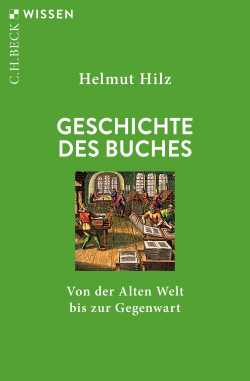«Was ist ein Buch?» Mit dieser knappen und durchaus berechtigten Frage beginnt Helmut Hilz seine, wie man wohl sagen kann, kurze Geschichte des Buches. Berechtigt ist die Frage vor allem deshalb, weil in der Darlegung dieser Geschichte von Hilz auch Schriftträger behandelt werden, die man landläufig nicht als ein Buch bezeichnen würde: Schriftrollen oder Inschriften zum Beispiel.
Das Buch ist ein sich stets wandelndes Medium und dieser Wandel schlägt sich nun einmal in einer Geschichte nieder. Wenn Hilz hier aber eine Geschichte erzählt, kann man nicht davon ausgehen, dass dieselbe schon vorliegt. Natürlich gibt es historische Hausnummern, an denen man sich orientieren kann. Die Entstehung der Keilschrift zum Beispiel oder die Drucke der Gutenbergschen Werkstatt. Aber diese Eckdaten dann zu einer kontinuierlichen Geschichte zu verbinden, bleibt dem Autor überlassen. Das ist nicht nur eine Arbeit der Recherche, die für den Bibliothekar und Historiker Hilz sozusagen Hausmannskost ist, sondern auch eine Arbeit der historischen Rekonstruktion.
Das heißt, eine Geschichte des Buches muss nicht unbedingt erst bei den Inkunabeln einsetzen. Und so verschlägt uns auch das erste Kapitel der Hilzschen Darstellung zu den frühen Schriftkulturen der «alten Welt». Diese methodologische Flexibilität im Umgang mit dem Buch- und Geschichtsbegriff erlaubt es den Leserinnen und Lesern, die tatsächliche Länge einer möglichen Geschichte des Buches kennenzulernen.
Aber wie weit Hilz diesen Begriff des Buches dann auslotet, ist hier noch nicht festgelegt. Man kann den Einbezug von Hieroglyphen und Papyrusrollen in den Begriff des Buches auch einfach als methodologische Vorbemerkung gelten lassen, die zur Plausibilität der dann folgenden Geschichte beitragen soll.
Doch da bekommen wir dann eine Geschichte präsentiert, die es nicht einfach nur mit dem Buch als physischem Gegenstand zu tun hat, sondern wo diese in einem Einband versammelten Blätter auch unter dem Gesichtspunkt ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz oder Brauchbarkeit wahrgenommen werden. So wird zum Beispiel ein Kapitel dem Lesen gewidmet – eine Kompetenz, die ja der Existenz von Büchern durchaus nicht abträglich ist. Und die auch sonst soziologische Aufschlüsse bietet, wie zum Beispiel, dass zwar nicht gesichert, wohl aber zu erwarten ist, dass im 16. Jahrhundert etwa eher die Städter in den Genuss der Alphabetisierung gekommen sind als die Landbewohner. Dieses unterschiedliche Leseverhalten der Bevölkerung sticht sich natürlich auch manchmal mit der Geschichte des Buches.
Darüber hinaus wird das Buch als gesellschaftliches Phänomen behandelt, etwa wenn es um die Bereitstellung der Bücher für einen Markt und damit also um den Buchhandel geht. Seien das nun lateinische Klassiker oder in ihrer Zeit verbotene Bücher von Galilei oder Descartes, die zu publizieren einige Verleger den Mut aufgebracht haben.
Aber nicht nur das Buch ändert sich, sondern natürlich auch dessen Gestalt. Von den mehreren Spalten auf einer Seite, wie man das heute noch im Bibelformat kennt, hin zu dem mittlerweile gängigen Fließtext. Oder auch die je verschiedenen, den Buchseiten beigelegten Illustrationen, deren Bedeutung nicht nur aus einem sinnlichen Interesse der Leserschaft herrühren muss. Man kann sich vorstellen, dass etwa medizinische Lehrbücher mit Bildern weit besser ausgestattet sind. Dasselbe gilt natürlich nicht nur für die Medizin. Man kann bei Grafiken tatsächlich als von einem wichtigen Motor für die Bildung durch das Buch sprechen.
Neben dieser Buchgestaltung wird der soziale Ort des Buches in den Blick genommen. Nämlich der seiner Aufbewahrung und seiner Verwendung, also wo sich Bücher am besten platzieren lassen oder wo sie gerne gelesen werden wollen: Die Bibliothek gehört mindestens ebenso wie das Kanapee zu einer Geschichte des Buches!
Man sieht also, dass die Geschichte, die Hilz uns hier aufbereitet, nicht bloß mit der Technik des Buchdrucks zu tun hat. Mehr noch, Hilz weiß sogar etwas in seine Geschichte zu integrieren, was wiederrum nichts mit dem Schrift oder Datenträger Buch zu tun hat. Nämlich die Zerstörung desselben, oder leider etwas genauer gesagt: die Verbrennung. Da wird aber nicht nur der sogenannten «Aktion wider den undeutschen Geist» von 1933 gedacht, sondern ebenso der Zerstörung von Bibliotheksbeständen etwa durch deutsche Truppen im belgischen Löwen 1914. Der von Hilz so bezeichnete «Krieg gegen die Bücher» ist nicht zuletzt auch ein Beweis für die symbolische Wirkkraft dieses Mediums.
Mit dieser historischen Marke sind wir in der Geschichte auch schon beinahe bis in unsere heutige Zeit vorangerückt. Da findet sich natürlich eine endlos lange Bibliographie an Publikationen, die sich mit dem digitalen Wandel des Buches beschäftigen. Von welchen sich übrigens kaum welche in dem ohnehin knappen Literaturverzeichnis von Hilz finden lassen. Das ist allerdings kein Nachteil. Hilz versteht es hier wiederrum, ein Phänomen in die Geschichte des Buches zu integrieren, welches normalerweise als das Ende desselben gehandelt wird. Hier geht es natürlich um die «Erfindung» des E-Books. Und das ist ein Vorzug der Darstellung von Hilz, dass seine kurze Geschichte sowohl Papyrusrollen als auch E-Books auf einen gemeinsamen Nenner bringen kann. Nämlich auf den des Buches.
Angenehm ist es, ein gewisses Gegenwicht zu verspüren, das gegen dieses oftmals verkündete und nicht selten in einem apokalyptischen Gehabe vorgetragene «Ende des Buches» ankämpft. Dabei ist das E-Book für Hilz lediglich die Fortsetzung des Buches mit anderen Mitteln.
Natürlich ist es ein, gelinde gesagt, engagiertes Projekt, diese Geschichte auf 123 Seiten zu skizzieren. Zu einer wirklichen Erzählung kann es da nicht kommen, aber das ist in der Reihe, in der das Buch erschienen ist, ja auch gar nicht so vorgesehen. Diese zusammengestellten Entwürfe von unterschiedlichen Wegmarken in der Geschichte des Buches sind allerdings nicht nur eine gute Übersicht, sondern bieten eine gute Quelle für eine noch zu schreibende «ganze» Geschichte des Buches.
Wer sich übrigens mehr für das Handwerkliche in der Herstellung des Buches interessiert und an dieser hier besprochenen Publikation den Fokus auch auf außereuropäische kulturelle Entwicklungen vermisst hat, sei auf eine, wenngleich nur leicht ausführlichere Publikation von Hilz verwiesen, die nur ein kleines Spiel mit dem Namen getrieben hat. «Buchgeschichte» (Berlin/Boston 2019) heißt die um ein paar Seiten längere und ausführlichere Darstellung.
Zitierweise:
Schönmann, Paul: Rezension zu: Hilz, Helmut: Geschichte des Buches, München 2022. Zuerst erschienen in: Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, Vol. 117, 2023, S. 449-451. Online: https://doi.org/10.24894/2673-3641.00155.