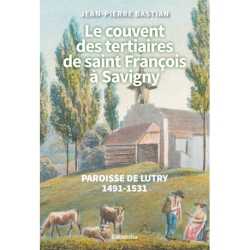Das vorliegende Bändchen, erschienen in dem sonst eher populärwissenschaftlich und heimatkundlich ausgerichteten Regionalverlag Cabédita im waadtländischen Bière, stellt eine vergleichsweise kurzlebige spätmittelalterliche Klostergründung im Bistum Lausanne vor. Es geht um die franziskanische Drittordensniederlassung in Savigny nordöstlich von Lausanne, an der Grenze zwischen dem Lavaux und dem Jorat. Das topographisch höher gelegene Gebiet war im Spätmittelalter vergleichsweise abgeschieden, geprägt von einer ärmeren Bevölkerung, die zu einem guten Teil aus frischen Einwanderern aus der Haute-Savoie und damit aus dem Bistum Genf bestand. Entsprechend knapp war der Konvent mit Schenkungen ausgestattet. Zu seinen Unterstützern zählte die Bürgerschaft des Städtchens Lutry am Genferseeufer, zu dessen Pfarrsprengel die Niederlassung in Savigny gehörte. Der Ursprung des Drittordenshauses liegt darin, dass der Lausanner Bischof Benedikt von Montferrand zwei Wochen vor seinem Tod am 7. Mai 1491 die zerfallene Kapelle von Savigny dem eigentlichen Klostergründer überliess, dem Eremiten Pierre de Roseto. Bei dieser Entscheidung mag mitgespielt haben, dass Benedikt von Monterrand seit 1478 in «Personalunion» auch Kommendatarprior von Lutry war.
Die durchaus interessierte «Freigiebigkeit» Bischof Benedikts verweist auf eine neue historiographische Fragestellung (die in der besprochenen Studie selbst nicht aufgegriffen wird): In der einheimischen Historiographie hat Benedikt von Montferrand einen ausgewiesen schlechten Ruf. Moniert wird u. A. die Kompromisslosigkeit, mit der er die bischöflichen Rechte zu bewahren bzw. neu einzufordern versuchte – dies, nachdem an der Spitze des Bistums nach 1465 eine Reihe ausnahmslos farbloser Männer gestanden hatte. Die Berufung der Drittordensleute in eine bislang vernachlässigte Gegend erscheint nun als reformatorischer Zug, ebenso der Umstand, dass derselbe Bischof anfangs September 1477, d. h. etwas mehr als ein Jahr nach seinem Amtsantritt in Lausanne, sowohl den Geistlichen wie auch den Laien seines Bistums gebot, sich von ihren Konkubinen zu trennen. Benedikt ist von der Geschichtsschreibung bislang weniger als Reformunterstützer denn als Machtpolitiker und auch Hexenjäger gesehen worden (so zusammenfassend Georg Modestin, «Controverses autour des procès de sorcellerie en ville de Lausanne pendant l’épiscopat de Benoît de Montferrand [1476–1491]», in: La sorcellerie et la ville. Witchcraft and the City, sous la direction d’Antoine Follain et Maryse Simon. Postface de Carlo Ginzburg, Strasbourg 2018, 51–61). Die vorliegende Studie regt jetzt dazu an, ein vermutlich ganzheitlicheres Bild des Prälaten zu sehen. Dass Hexenjagd und Kirchenreform zwei Seiten ein- und derselben Medallie sein konnten, illustriert das Beispiel von Georg von Saluzzo, als Bischof von Lausanne (1440–1461) ein Amtsvorgänger Benedikts.
Die in Savigny niedergelassenen Franziskanertertiare mussten um ihre Niederlassung kämpfen. Ab 1496 wurden sie vom Lausanner Domkapitel, das ihnen die Überlassung der Kapelle von Savigny streitig machte, in einen langwierigen Rechtshändel verwickelt. In diesem Prozess, der bis vor den Papst getragen wurde und dessen Ende unbekannt ist, argumentierte das Kapitel, Benedikt von Montferrand habe hinsichlich der besagten Kapelle seine Kompetenzen überschritten, wozu er nicht befugt gewesen sei. Das Verfahren, das vom Papst dem Offizial des bischöflichen Gerichts in Basel übertragen wurde und zeitweise auch den Humanisten Sebastian Brant beschäftigte, hat ein reichhaltiges Quellenkonvolut hervorgebracht, das im rezensierten Band angesprochen, aber nicht erschöpfend behandelt worden ist. Ein Desiderat wäre auch eine Edition dieser Quellen.
Die Niederlassung in Savigny hatte eine recht prekäre Existenz, vom Domkapitel – letzlich erfolglos, wie es scheint – in Frage gestellt und materiell in einem wirtschaftlich strukturschwachen regionalen Umfeld eher knapp dotiert. Diese zweite Schwierigkeit scheint das Überleben der Einrichtung verkürzt zu haben, was sich insbesondere in bedrohlichen Rekrutierungsschwierigkeiten zeigte. 1531 wurden schliesslich die Rechte und Einkommen des kleinen Konvents von Savigny der Gemeinde Lutry übertragen – fünf Jahre vor der Reformation, die in der Waadt im Nachgang zur bernischen Eroberung Einzug hielt.
Mit seiner Darstellung bietet der Verfasser, emeritierter Professor für Religionssoziologie an der Universität Strassburg, willkommene Einblicke in ein bislang vernachlässigtes Kapitel aus der mittelalterlichen Kirchengeschichte der Westschweiz.
Zitierweise:
Modestin, Georg: Rezension zu: Bastian, Jean-Pierre: Le couvent des tertiaires de saint François à Savigny, parois-se de Lutry 1491–1531, Bière 2020. Zuerst erschienen in: Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, Vol. 117, 2023, S. 436-437. Online: https://doi.org/10.24894/2673-3641.00155.