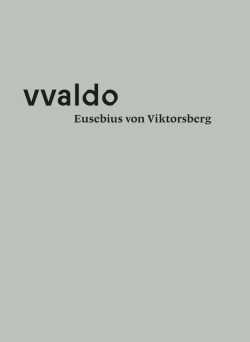Der in diesem Buch behandelte Eusebius von Viktorsberg ist eine der eigentümlichsten Gestalten unter den churrätischen Heiligen. Er gehört zu den irischen Wandermönchen, die im 9. Jahrhundert ihre Heimat verliessen und auf dem Kontinent ihr Leben zubrachten. Wie andere Iren suchte Eusebius die Nähe zum Kloster St. Gallen und zum Grab seines Landsmanns, des heiligen Gallus. Er blieb aber nicht im Kloster und wirkte nicht hier wie etwa der gelehrte Ire Marcellus, der den Ruhm der St. Galler Klosterschule mitbegründete, sondern er lebte als Einsiedler während dreissig Jahren auf dem Viktorsberg oberhalb von Röthis im heutigen Vorarlberg, wo er am 31. Januar 884 starb. Einen zeitgenössischen Biographen hat Eusebius wie so manche andere, namenlos gebliebene irische peregrini nicht gefunden. Der Kult des Reklusen an seinem Grab muss bescheiden und lokal begrenzt geblieben sein; denn das Heiligtum auf dem Berg behielt den Namen und das Patrozinium eines Märtyrers Viktor, dessen Schädel wohl seit dem 8. Jahrhundert auf dem Viktorsberg als wertvolle Reliquie aufbewahrt und verehrt wurde.
Das Leben des Eusebius wäre für immer in Vergessenheit geraten, wenn es nicht einen Niederschlag in der schriftlichen Überlieferung St. Gallens hinterlassen hätte. Der St. Galler Mönch und Zeitgenosse Ratpert berichtet in seinen Klostergeschichten (Casus sancti Galli) über Eusebius, sein freiwilliges, dreissig Jahre dauerndes Reklusentum und seinen Tod. Und die Sterbenotiz im Kapiteloffiziumsbuch des Klosters belegt das Gebetsgedenken an den Einsiedler auf dem Berg. Weitere, indirekte Nachrichten liefern zwei Urkunden Kaiser Karls III. für St. Gallen von 882 und 885, mit denen er den nicht unbedeutenden Fernbesitz des Viktorsbergs an das Kloster übertrug und die Bergkirche mit zusätzlichen Einkünften ausstattete: Hier hatte sich inzwischen eine kleine klösterliche Gemeinschaft von Iren gebildet, und ein Hospiz zur Aufnahme von zwölf Pilgern wurde eingerichtet. Doch ein Jahrzehnt später war davon nichts mehr vorhanden; der Niederlassung irischer Mönche war offenbar keine Dauer beschieden.
Die Erinnerung an Eusebius griff nach Ratpert im 10. Jahrhundert dessen Fortsetzer der St. Galler Klostergeschichten, Ekkehart IV., auf und formte sie legendenhaft aus. Nun erscheint der Rekluse als Traumdeuter und Berater. Er soll einen Traum der schwangeren Mutter des künftigen St. Galler Mönchs und Lehrers Iso (um 830–871) ausgelegt haben – was aus zeitlichen Gründen ausgeschlossen ist – und auch Kaiser Karl geweissagt haben. Den geschichtlichen Hintergrund dafür mag eine historische Beraterfunktion des Eusebius unter den lokalen Eliten des Bodenseeraumes gebildet haben. Die Tendenz, den Einsiedler auf dem Viktorsberg mit legendenhaften Zügen auszustatten, setzte sich in der späteren Tradition noch viel deutlicher fort. Zunächst reisst die Überlieferung aber bis knapp nach 1500 ab. In der frühen Neuzeit erlebte nun Eusebius einen erzählerischen Aufstieg «von einer historisch nur spärlich belegten Person [...] zur legendarisch verklärten und zur theologisch hochgradig aufgeladenen und überhöhten, literarischen Gestalt, die im 18. Jahrhundert (1730/31) schliesslich heiliggesprochen wurde» (19). Im Jahr 1598 veröffentlichte der Überlinger Erbauungsschriftsteller Johann Georg Schinbain (Tibianus) eine Legende des Heiligen mit völlig neuen Elementen: Eusebius wurde nun als eifriger Kämpfer gegen die (bäuerliche) Sonntagsarbeit dargestellt, der bei Brederis im Rheintal bei der Heuernte im Juli von einem zornigen Bauern mit einer Sense geköpft wurde; dann nahm Eusebius seinen Kopf in die Hände und trug ihn auf den Viktorsberg hinauf, wo er begraben werden wollte. Dadurch wurde Eusebius zum Märtyrer für die Sonntagsheiligung, und seine Legende als Kopfträger übernimmt das Motiv aus Erzählungen anderer rhätischer Kopfträger (Kephalophoren).
Diese neue Legende wirkte bis in das Kloster St. Gallen; hier nahm man den Kopfträger Eusebius als Landsmann des heiligen Gallus gerne in den Reigen der Hausheiligen auf und baute ihn literarisch, liturgisch, bildlich und plastisch zum ersten Märtyrer (Protomartyr) auf. Im Jahr 1730 gestattete die römische Ritenkongregation St. Gallen und allen Klöstern der Schweizer Benediktinerkongregation, Eusebius vom Viktorsberg liturgisch feiern zu dürfen. Im folgenden Jahr fand in barocker Prachtentfaltung die feierliche Translation einer Reliquie des neuen Heiligen vom Viktorsberg in die Stiftskirche St. Gallen statt. Im Jahr nach der Aufhebung des Minoritenkonvents, der seit 1517 auf dem Viktorsberg bestanden hatte, durch Kaiser Joseph II. 1785 erhielt die Fürstabtei auch die wichtigste Reliquie des Heiligen, seinen Schädel.
Die vorliegende Publikation vereint alle aufgefundenen Textzeugnisse, darunter auch bisher unbekannte, und Kunstgegenstände aus der Zeit des Klosters St. Gallen, die zu Eusebius greifbar sind, in einem Band und stellt sie in Text und Bild vor. Damit erfüllt sie ein Postulat des Managementplans des UNESCO-Welterbes Stifts-bezirk St. Gallen, nämlich die Erstellung eines kulturgeographischen Inventars. In siebzig chronologisch geordneten Nummern, von der Klosterchronik des Zeitgenossen Ratpert bis zu einem (leeren) Translationskistlein aus der Zeit um 1800, werden die Texte und Gegenstände zu Eusebius präsentiert und sachkundig beschrieben. Die Beschreibungen stammen aus der Feder eines vierköpfigen Autorenkollektivs, wobei Michael Fröstl die überwiegende Zahl der Beschreibungen beigesteuert hat. Das Buch ist ansprechend gestaltet, gut gegliedert und mit qualitätvollen Abbildungen hervorragend illustriert. Es hat das originelle, handliche Oktav-Format und beschreitet mit seinem fehlenden festen Vorderdeckel buchgestalterisch neue Wege. Hervorzuheben ist auch der ausgesprochen günstige Preis, obwohl das Buch in der Schweiz hergestellt wurde. Es ist Teil der neuen Publikationsreihe vvaldo des Stiftsarchivs St. Gallen. Namengeber für diese im Jahr 2020 begonnene Reihe, die bisher neben fünf Bändchen in der Hauptreihe bereits je ein Bändchen in den Unterreihen «vademecum» und «additamenta» hervorgebracht hat, ist der St. Galler Mönch und Schreiber Waldo († 813/14), passenderweise der erste namentlich bekannte Archivar des Gallusklosters. Waldo war eine herausragende Gestalt in der Frühzeit St. Gallens, er wurde später dessen Abt, dann Abt der Reichenau, von St-Denis und Bischof von Basel und war einer der Vertrauten Karls des Grossen. Dem gelungenen Band ist eine gute Aufnahme und der neuen Reihe sind weitere solche Veröffentlichungen zu wünschen.
Zitierweise:
Tremp, Ernst: Rezension zu: Eusebius von Viktorsberg, hg. von Erhart, Peter, mit Beiträgen von Erhart, Peter; Fröstl, Michael; Ganz, Ulrike; Kaiser, Markus, (vvaldo – vademecum II), St. Gallen 2023. Zuerst erschienen in: Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, Vol. 117, 2023, S. 431-433. Online: https://doi.org/10.24894/2673-3641.00155.