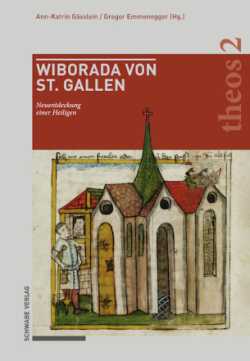Der Untertitel des Bandes irritiert, er verlangt nach einer Erklärung: Ist Wiborada im Umfeld St. Gallens nicht bereits seit langem und in der feministischen Geschichtsschreibung seit einiger Zeit eine sehr bekannte, quellenmässig bestens dokumentierte und gut erforschte historische Gestalt? Für wen sollte das Buch eine Neuentdeckung der Heiligen bieten? Mit dieser Frage im Hinterkopf beginne ich mit der Lektüre der elf Aufsätze des Sammelbandes. Der einleitende Beitrag der beiden Herausgeber Ann-Katrin Gässlein und Gregor Emmenegger, «Die erste Schweizer Heilige – eine Neuentdeckung», gibt erste Antworten: Es geht um Neuinterpretationen Wiboradas aus unterschiedlichen Perspektiven, vom Hintergrund der spätantiken und frühchristlichen Geschichte der Einsiedler und Inklusen bis zur Gegenwart, zur zeitgenössischen Debatte rund um frauenspezifische Anliegen wie dem Jubiläum fünfzig Jahren Frauenstimmrecht in der Schweiz im Jahr 2021. Im gleichen Jahr hat Wiborada in St. Gallen eine originelle, vielbeachtete Neubelebung erfahren: Während zehn Wochen lebten Frauen und Männer im Frühling 2021 als Inklusen in einer neu errichteten Zelle an der Kirche St. Mangen. Durch ein Fenster waren sie mit der Aussenwelt verbunden und erhielten Einblicke in die Sorgen und Nöte der Stadtbevölkerung. Dazu wurde Abend für Abend in ökumenischem Geist eine Gebetszeit angestimmt. Mit dieser weitgespannten Thematik soll der Band «wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht [werden] und zugleich für interessierte Laien und Laiinnen [sic] zugänglich» sein (25). – Auf soliden wissenschaftlichen Boden führt der Aufsatz von Gregor Emmenegger, «Warum hat sich Wiborada einmauern lassen? Motive und Leitbilder aus der christlichen Tradition». Er zeigt die lange, bis ins syrische 5. Jahrhundert zurückreichende Tradition von prophetischen Inklusinnen auf. In der westlichen Kirche mildert der klösterliche Kontext etwa des iroschottisch-columbanischen Mönchtums das Inklusentum zu einer massvolleren Askese. Unter dem Einfluss der Benediktsregel schrieb zu Beginn des 10. Jahrhunderts, also zu Lebzeiten Wiboradas, Grimlaicus eine Regel für als Einsiedler lebende Mönche und Nonnen; darin entwickelte er eine Theologie des kontemplativen Lebens. Das Bemühen um Kontrolle von Reklusen ausserhalb von Klöstern leitete auch Synoden und Konzilien seit dem 7. Jahrhundert; solange ein Bischof oder ein Abt über eine solche Lebensweise wachte, war gegen sie nichts einzuwenden. Die Frage nach den Beweggründen Wiboradas, Inklusin zu werden und damit in St. Gallen die Tradition der virgo Dei zu begründen, kann nur indirekt beantwortet werden. Die älteste Vita von Ekkehart I. lässt die Motive der historischen Wiborada fast ganz hinter dem hagiographischen Archetyp der «heiligen Frau» zurücktreten. Genährt durch die Tradition, entwirft die Erzählung ein Lebenskonzept, das späteren Inklusen als Regel dienen wird. – Cornel Dora, «Was wir über Wiborada wissen. Ein Blick in die historischen Quellen», stellt die reich fliessenden Quellen über die Heilige zusammen, über die mehr und Verlässlicheres als über jede andere Schweizer Frauengestalt des Frühmittelalters überliefert ist. Lange vor den beiden Viten Ekkeharts I. um 960/70 und Herimanns um 1072/76 bezeugt der Eintrag im St. Galler Professbuch eine singuläre, frühe Memoria der Heiligen, dazu kommen Einträge im Kapiteloffiziumsbuch und in den St. Galler Annalen. Spätestens im Zusammenhang mit der Kanonisierung 1047 entstanden Werke der liturgischen Heiligenverehrung, namentlich das Wiboradaoffizium. In der bildlichen Vermittlung der Heiligen und ihres Lebens spielt der Zyklus von 53 Bildern im deutschsprachigen St. Galler Legendar aus der Mitte des 15. Jahrhunderts heute eine wichtige Rolle. Vorgestellt werden auch die Erinnerungsorte des Wiboradagedenkens, ihr Häuschen bei der Kirche St. Georgen, ihre Zelle bei St. Mangen und die dortige Wiboradakapelle, die anlässlich der Erhebung ihrer Gebeine 1453 errichtet wurde. Beim Bildersturm 1528 wurde dieser wichtigste Träger ihrer Memoria samt den Reliquien zerstört. – Cornel Dora, «Die Wiborada-Objekte im Kloster Glattburg», teilt die Ergebnisse der C14-Analyse von drei heute im Benediktinerinnenkloster Glattburg bei Oberbüren verehrten hölzernen Erinnerungsstücken an Wiborada mit: Der Holzklotz, der der Heiligen als Kopfkissen gedient haben soll, stammt aus nachmittelalterlicher Zeit, der Hocker (oder das Tischchen) kann ins 11. Jahrhundert datiert werden, vielleicht in die Zeit der Heiligsprechung 1047, und das Brustreliquiar könnte im Zusammenhang mit der Erhebung ihrer Gebeine 1453 entstanden sein. – Esther Vorburger-Bossart, «Erforscht und vergessen. Wiborada in der Stadt und im Bistum St. Gallen im 20. und 21. Jahrhundert», setzt sich in diesem kenntnisreichen Beitrag mit der Erforschung und Verehrung der Heiligen in der jüngsten Vergangenheit und in der Gegenwart auseinander. Da ihre Hauptgedenkstätte in St. Mangen seit der Reformation nicht mehr existierte, blieb die Rezeption lange Zeit im Wesentlichen auf den Ort der schriftlichen Überlieferung, die Stiftsbibliothek, und die wissenschaftliche Beschäftigung beschränkt. Verdienstvoll für die Wiederbelebung des Interesses an Wiborada war der langjährige Stiftsbibliothekar Johannes Duft. Im Bistum St. Gallen boten gegen Ende des 20. Jahrhunderts Seelsorgerinnen und danach das Wiboradajahr 2011 im Rahmen des Bistumsprojekts «ganz schön heilig» den Anstoss zur Neuentdeckung der Heiligen. Seither lebt eine Diözesaneremitin das Leben in Stille und Zurückgezogenheit. Ausserhalb der katholischen Kirche sind die Gründung der Frauenbibliothek Wyborada 1986, verschiedene literarische und lyrische Werke, Stadtführungen, Lehrmittel für den Unterricht, Fernsehsendungen u. a. m. zu nennen, welche die verschiedenen Stränge der heutigen WiboradaRezeption ausmachen. – Eva Dietrich, «Die Wüste, die Klause und der (un)sichtbare Körper. Askese im religionswissenschaftlichen Vergleich», bettet die Askese Wiboradas in die asketi-schen Strömungen ein, die sie vom Buddhismus und Hinduismus bis zu Antonius dem Einsiedler aufzeigt. – Ann-Katrin Gässlein, «Wiborada in der Einsamkeit. Interreligiöse Annäherungen», situiert die selbstgewählte Einsamkeit Wiboradas innerhalb der Religionsgeschichte und der Religionsphänomenologie, wobei sie insbesondere Parallelen aus der alttestamentlich-jüdischen Tradition heranzieht. – Roland Gröbli, «‹Scio mulier sancta es›. Wiborada von St. Gallen als idealtypisches Vorbild für Niklaus von Flüe», spürt der interessanten Frage nach, wieweit der Innerschweizer Eremit von Wiborada Kenntnis hatte und sich von ihrem Leben inspirieren liess. Eine direkte Verbindung lässt sich nicht nachweisen, ein möglicher Vermittlungsstrang könnte über den Einsiedler Dekan Albrecht von Bonstetten gelaufen sein. Zwischen den beiden Heiligen gibt es Gemeinsamkeiten. So wurden beide zu Lebzeiten als «lebende Heilige» wahrgenommen, beide lebten an einem festen Ort, in einer Zelle, und wurden von vielen Menschen um Rat und Hilfe aufgesucht, beide gehören «zum kleinen Kreis der Propheten und Prophetinnen der Geistkirche, welche die Amtskirche [...] herausfordern und bereichern» (264). Gerne hätte man die Auflösung des lateinischen Titelzitats erfahren (Judith 8,29), und Fehler wie «Hugo von St. Victoire» (262) hätten einer aufmerksamen Redaktion nicht entgehen dürfen. – Birgit JeggleMerz, «‹Veni sponsa Christi, accipe coronam›. Das Gedenken der Hl. Wiborada in der Liturgie der Kirche», untersucht die liturgischen Texte zum Wiboradafest am 2. Mai, die bis zur Liturgiereform im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils in Gebrauch waren bzw. heute verwendet werden, insbesondere den auf Ambrosius zurückgehenden Hymnus «Jesu, corona virginum», den Wiboradahymnus «Festum diem Wiboradae», den wahrscheinlich Ekkehart I. geschaffen hat, das ebenfalls von Ekkehart I. am Ende seiner Vita gedichtete, als Vesperhymnus verwendete Epitaph «Wiborada, Deo meritis», die Texte zur Vesper des Offiziums, einen Hymnus aus dem 14. Jahrhundert sowie die Gebetstexte der Eucharistiefeier (darunter den in den Aufsatztitel aufgenommenen Introitusvers) und interpretiert diese Texte in der Feier des Heiligengedächtnisses als Teilhabe am Pascha-Mysterium. – Ann-Katrin Gässlein, «Täglich Psalmen beten. Wiborada als Inspiration für neue liturgische Ausdrucksformen», berichtet von den Erfahrungen von «Wiborada 2021», als Frauen und Männer während zehn Wochen als Inklusen in der neu errichteten Zelle an St. Mangen lebten und in den abendlichen Gebetszeiten des Rahmenprogramms auch Psalmen gesungen wurden. – Judith Thoma, «Eine weibliche Stimme und das Frauenstimmrecht», nimmt das Gemälde, das Ferdinand Gehr 1931 in der Kirche St. Georgen gemalt hat und wo Wiborada in der Mitte zwischen Gallus und Otmar mit Priesterstola spirituell erhöht dargestellt ist, als Ausgangspunkt und beleuchtet die Entwicklung des Frauenstimmrechts in der Schweiz «im Sinne einer Polemik» (342) bis zu dessen Einführung 1971 und bis zur Gegenwart, in der «die katholische Kirche einer der letzten Männerbünde mit entsprechenden Privilegien» ist (354). – Gegen die in diesem gehaltvollen Buch vielfältig und mit Überzeugung vorgetragene neue Rolle Wiboradas im Zusammenhang der Frauenbewegung im kirchlichen wie auch im weltlichen Bereich ist aus der Sicht des Historikers nichts einzuwenden. Es ist zu wünschen, dass das bevorstehenden Wiborada-Jubiläumsjahr 2026 sich von diesen neuen Impulsen inspirieren lässt.
Zitierweise:
Tremp, Ernst: Rezension zu: Wiborada von St. Gallen. Neuentdeckung einer Heiligen (Theologisch bedeutsame Orte der Schweiz 2), hg. von Gässlein, Ann-Katrin; Emmenegger, Gregor, Basel 2022. Zuerst erschienen in: Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, Vol. 117, 2023, S. 429-431. Online: https://doi.org/10.24894/2673-3641.00155.