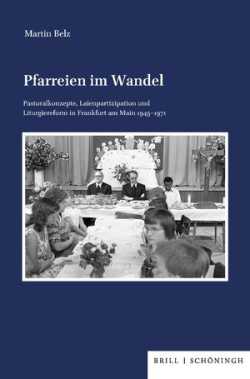Auch wenn seit vielen Jahren über die Krise der Pfarrei und der Gemeindetheologie geklagt und geschrieben wird: In historischer Perspektive ist die Frage, ob es sich bei der Pfarrei um ein Erfolgsmodell handelt oder seit wann sich ihr Scheitern absehen lässt und wie es dazu gekommen ist, bislang nur begrenzt aufgearbeitet worden. Insofern ist das Erscheinen der Dissertation von Martin Belz über Pfarreien im Wandel in Frankfurt zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und den Anfängen der Konzilsrezeption (Verfasser nimmt das Jahr 1971 als Schlusspunkt) sehr zu begrüßen.
Wichtige Gründe, warum bislang so wenig Pfarrgeschichte betrieben wurde, deuten sich bei der Lektüre schnell an. Anfang der 1960er Jahre existierten in Frankfurt 45 eigenständige Pfarreien (31). Der Verfasser musste also auswählen und anhand von Kriterien wie der sozialen Zusammensetzung der Pfarrmitglieder, der Größe der Pfarreien oder der Lage in der Stadt aussuchen. Diese Herausforderung wurde zusätzlich durch die unterschiedliche archivalische Überlieferung und Erschließung erschwert, die eine vertiefte Beschäftigung mit einigen Pfarreien gar nicht erst möglich werden ließ. Untersucht wird so die Geschichte der Frankfurter Pfarreien anhand von vier Beispielen, zwei eher mittelständisch geprägten Gemeinden im Norden, einer Gemeinde in Sachsenhausen und einer Arbeiterpfarrei im Gallusviertel, westlich des Hauptbahnhofs.
Genauso schwierig wie die Auswahl der Pfarreien gestaltet sich die Auswahl der Fragen, mit denen ihre Geschichte untersucht werden soll, bietet sich doch eine Überfülle an möglichen Themen an. Der Verfasser entschied sich für drei Perspektiven. Ein erstes Kapitel beschäftigt sich mit «Strukturen, Konzepten und Themenfeldern der Pastoral». Ein zweites Kapitel nimmt die Rolle der Laien in den Blick. Das letzte Hauptkapitel analysiert die liturgische Erneuerung. Der Vorteil eines solchen Ansatzes ist, dass auf diese Weise die genannten Felder sehr genau in den Blick genommen werden können. Nachteilhaft sind die vielen Wiederholungen: alle Kapitel sind chronologisch aufgebaut, und an einigen Stellen, etwa wenn es um die Liturgische Bewegung oder die Konzilsrezeption geht, werden Themengebiete getrennt, die sich im Zusammenspiel besser verstehen lassen.
Das Kapitel über die pastoralen Strukturen und Konzepte beschreibt in beeindruckender Weise drei Transformationen, angefangen von den großen Rechristianisierungshoffnungen der unmittelbaren Nachkriegszeit über erste pastorale Neuaufbrüche während der 1950er und der frühen 1960er Jahre bis zu den pastoralen Veränderungen nach dem Konzil. Diese drei Transformationen werden an verschiedenen Feldern verdeutlicht. Besonders eindrücklich wird so etwa die Entwicklung der Jugendpastoral geschildert. In der unmittelbaren Nachkriegszeit baute sie auf der Idee einer Standesseelsorge auf, die stark von auf die entsprechende Zielgruppe gerichteten Predigten geprägt war. Es folgte bereits vor dem Konzil ein neues, wesentlich offeneres Modell. In sogenannten «Clubs» (121), 1956 wurde ein solcher erster Club eröffnet, standen für sowohl männliche als auch weibliche Jugendliche v.a. Freizeitangebote im Vordergrund. In der Nachkonzilszeit setzte sich diese Form der Jugendpastoral weiter durch. Die «stark kirchlich-religiös verankerten Konzepte der Jugendarbeit» waren damit endgültig «passé, jetzt standen Selbsterfahrung und Persönlichkeitsbildung an vorderster Stelle» (166).
Das folgende Kapitel trägt den Titel «Apostolat in der Welt und Mitverantwortung in der Kirche: Rollenverständnis und Partizipation der Laien». Der Titel ist insofern missverständlich, weil es ausschließlich um die Partizipation von Laien in bestimmten Gremien geht, angefangen von den ersten Organisationsformen der Katholischen Aktion, deutschlandweit bekannt wurde v.a. die «Katholische Volksarbeit», bis zu ihrer nachkonziliaren Umgestaltung. Auch hier überzeugt, dass der Verfasser präzise und detailliert den Entwicklungsprozessen nachgeht. Das Fazit fällt differenziert aus. Mit Blick auf die Leitbegriffe hält Belz fest: «In den ersten beiden Nachkriegsdekaden dominierte die Rede vom Apostolat der Laien, das [...] zunächst unter strenger hierarchischer Kontrolle erfolgen sollte. [...]. Seit dem Konzil galten Mitverantwortung und Mitentscheidung als die einschlägigen Stichworte, wobei die Laien seitdem auch in die Aufgaben des kirchlichen Heilsdienstes einbezogen wurden.» (290). Gleichzeitig erfolgte die konkrete Umsetzung recht unterschiedlich, da auf die Frage, wie weit eine Demokratisierung der Kirche gehen könne, die Pfarrer keine einheitliche Meinung vertraten.
Es folgt ein Kapitel über das in den vorigen Seiten mehrfach angesprochene Gottesdienstleben und seine Reform. Sein erster Teil über die von der Liturgischen Bewegung angestoßene Seelsorge vom Altar her führt zum bereits vorgestellten Kapitel über Strukturen, Themenfelder und Konzepte der Pastoral zurück. Ausführlich und besonders interessant sind die Ausführungen über die liturgischen Experimente v.a. im Bereich der Jugendpastoral und der Ökumene nach dem Zweiten Vatikanum: «Die Vielfalt der liturgischen Gestaltungen, die die Pfarreien in der Nachkonzilszeit [...] erprobten, verweist auf eine starke Pluralisierungstendenz in der katholischen Liturgie.» (428).
Die Studie von Belz stellt eine beachtliche Leistung dar. Das Fazit verstärkt den positiven Eindruck mit einigen klar formulierten Thesen. Hervorzuheben sind seine Beobachtungen zu den Reformbemühungen der 1950er Jahre in Bezug zum Zweiten Vatikanischen Konzil: «Das Zweite Vatikanische Konzil stand somit einerseits am Beginn einer neuen Epoche und war andererseits in längerfristige Transformationsprozesse eingebettet.» (200).
Dabei spricht sich Belz mit Blick auf längerfristige Umbruchsprozesse sowohl für die These einer Säkularisierung im Sinne einer Ausdifferenzierung als auch für das Aufkommen von Transformationen aus, die nach Auffassung des Verfassers als innerkatholische Pluralisierung und Neuformierung zu verstehen sind. Gerade der zweite Teil, die innerkatholische Pluralisierung, wird noch genauer zu diskutieren sein, ist doch seit den 1960er Jahren gleichzeitig auch ein Pluralitätsverlust z. B. im Rückgang an Ordensgemeinschaften zu kon¬statieren. Dabei ist zu bedauern, dass die vom Verfasser in der Einleitung vorgestellte Milieutheorie nicht weiter im Fazit vor dem Hintergrund der Frankfurter Ergebnisse thematisiert wird.
Es ist zu hoffen, dass die Studie auch Anlass zur weiteren Forschung gibt, v.a. um Perspektiven aufzugreifen, die in ihr zwar vorkommen, aber wenig Raum einnehmen. Dazu gehört der Blick auf den Eigensinn der Pfarrmitglieder. So fällt auf, dass Verfasser primär über den Blickwinkel der Seelsorger und ihre Intentionen schreibt, die aber nicht unbedingt deckungsgleich mit denen der Pfarrmitglieder sein müssen. Selbst im Kapitel über die Partizipation der Laien geht es genau genommen vorrangig um die Vorstellung von Klerikern über die Partizipation von Laien und um die Reaktionen der Laien auf diese Pläne. Die einzelnen von Belz analysierten Konfliktgeschichten, egal ob es um Auseinandersetzungen über den Kirchenbau oder Diskussionen um die Gestaltung von Jugendgottesdiensten geht, machen aber neugierig, wie die Pfarreien auch unabhängig von den großen Fragen der Neukonzeptionierung der Seelsorge das Leben der Katholikinnen und Katholiken, von den selbst in den 1950er Jahren die meisten nicht mehr an der Osterkommunion teilnahmen, prägten. Es würde sich – nicht zuletzt in geschlechtergeschichtlicher Perspektive – lohnen, verstärkt den Blick auf den Eigensinn der Pfarrmitglieder zu lenken.
Zitierweise:
Henkelmann, Andreas: Rezension zu: Belz, Martin: Pfarreien im Wandel. Pastoralkonzepte, Laienemanzipation und Liturgiereform in Frankfurt am Main 1945–1971 (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B, 142), Paderborn 2022. Zuerst erschienen in: Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, Vol. 117, 2023, S. 426-428. Online: https://doi.org/10.24894/2673-3641.00155.