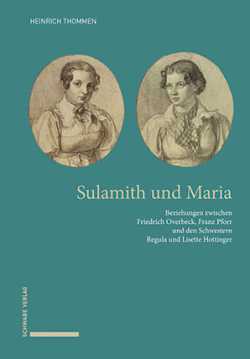Heinrich Thommen, Jurist und Kunsthistoriker, Gründer der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts Olten, hat sich in mehreren Publikationen als profunder Kenner der Kunst der deutschen und schweizerischen Romantik erwiesen. Hingewiesen sei auf sein Buch «Im Schatten des Freundes. Arbeitsmaterialien von Franz Pforr im Nachlasss Ludwig Vogels» (Basel 2010). Das Buch richtete, ausgehend vom Werkbestand und Nachlass des späteren Landschaftsmalers Vogel, den Blick auf über 150, bisher nicht bekannte Pforr-Zeichnungen. Im Zentrum der zu besprechenden vorliegenden Publikation stehen zwei Gemälde, die je zwei Frauen bzw. «zwei Bräute» zeigen. «Sulamith und Maria» wurde 1811 von Franz Pforr (1788–1812) gemalt, das andere Gemälde, «Italia und Germania» genannt, wurde von Friedrich Overbeck (1789–1869) um 1811 entworfen und erst 1828 fertiggestellt. Die Künstler, Pforr aus Frankfurt und Overbeck aus Lübeck, konzipierten die beiden Bilder als Ausdruck ihrer Freundschaft im Rahmen des «Lukasbundes». Pforr verfasste zu seinem Bild eine Schrift, das «Buch von Sulamith und Maria», eine Liebes- und Heiratsgeschichte zweier Mädchen; er schenkte die Schrift zusammen mit dem gleichnamigen Gemälde dem Freund Overbeck. Trotz zahlreicher Publikationen zu den beiden erwähnten Gemälden galten sie bislang als letztlich nicht deutbar und als Ausdruck von «Jünglingsphantasien». Heinrich Thommen nahm sich vor, dieses Urteil auf verschiedenen Ebenen zu revidieren.
Eine Einführung über die Entstehung der Künstlergruppe des «Lukasbundes» erleichtert den biographisch-historischen Einstieg. Es waren sechs, zuvor an der Wiener Kunstakademie eingeschriebene Studenten, welche den sogenannten «Lukasbund» gründeten. Zu ihnen gehörten die Maler Franz Pforr, Friedrich Overbeck, Ludwig Vogel, Konrad Hottinger, Joseph Wintergerst und Joseph Sutter. Während der Kriegssituation in Wien zwischen 1807 und 1810 pflegten die jungen Künstler einen von der Forschung bisher nicht aufgearbeiteten, engen Kontakt zur Familie Hottinger, der zu spektakulären Vorfällen führte. Zwei Maler der Gruppe, Pforr und Overbeck, betätigten sich auch literarisch. Ihre Oden, Gedichte und Legenden widerspiegeln ihre persönliche Entwicklung und die sich ändernden Beziehungen innerhalb der Gruppe. Der Autor erarbeitet die vielfältigen literarisch-biographischen Aspekte in sieben Kapiteln. Sie bilden den Hauptteil des Buches (S. 19–203). Den Anmerkungen (S. 203–237) folgen 22 Annexe (S. 239–300), Briefe, Gedichte und Prosatexte von Franz Pforr und Friedrich Overbeck, sowie kleine Abhandlungen, namentlich von Konrad Ludwig Schwab, Heinrich Stieglitz und Georg Christian Braun.
In Wien, wo die Kunststudenten sich malerische Fähigkeiten erworben und Beziehungen untereinander geknüpft hatten, spielten die Themen Geschichte, Freundschaft und Religion eine zentrale Rolle. Freundschaften konnten zerbrechen, so im Dezember 1807 jene zwischen Franz Pforr und seinem Frankfurter Jugendfreund Carl Jung. Grund war Pforrs Hinwendung zu Franz Overbeck, mit dem er in der Wertschätzung des «Mittelalters» wetteiferte; Pforr begeisterte sich für Dürer, und Overbecks Ideal war Raffael. Gemeinsam teilten sie das Geheimnis um Overbecks Liebe zu Regula Hottinger («Sulamith») und das Interesse an religiösen Fragen; Pforr und Overbeck pflegten zudem in dieser Zeit die gemeinsame tägliche Bibellektüre.
Der aus Zürich stammende Geschäftsmann und Seidenhändler Johannes Hottinger (1760–1809) hatte sich mit seiner Familie im Wiener Vorort Gumpendorf niedergelassen; einer der Söhne, Konrad (1788–1827), besuchte ebenfalls die Kunstakademie. Im Kreis der kinderreichen Familie, mit den beiden heranblühenden Töchtern Regula (1785–1865) und Lisette (Elisabeth, * 1787), fanden die Malerfreunde bei «Musik, Lektüre und munterem Gespräch» Erholung. Doch als Napoleon im Mai 1809 ein zweites Mal vor Wien stand und die Kunstakademie sich verkleinern musste, verloren «Ausländer» wie Overbeck, Pforr, Wintergerst und Vogel ihre Plätze. In ihrer isolierten Lage gründeten die Freunde am 10. Juli 1809 den bereits erwähnten «Lukasbund», in Anlehnung an frühere, dem Hl. Lukas unterstellte Bruderschaften. Mit Ludwig Vogel fassten drei der «Lukasbrüder» ihren Umzug nach Rom ins Auge. Am 10. Mai 1810 nahmen sie noch an der Hochzeit von Konrad Hottingers Schwester Regula teil, wenige Tage später reisten sie nach Rom ab, Overbeck «mit blutendem Herzen». Zwei Farbtafeln zeigen die beiden Schwestern Lisette und Regula, gezeichnet 1808 von Ludwig Vogel.
Bereits 2010 lancierte der Autor die Frage, ob nicht die Schwestern Regula und Lisette Hottinger das reale Urbild der beiden Gestalten «Sulamith» und «Maria» sein könnten. Die Frage wieder aufgreifend, geht Heinrich Thommen in dieser Studie von folgender These aus. Zum einen setzt er die «stille Neigung» Overbecks zu Regula Hottinger in Beziehung zur tatsächlichen Hochzeit Regulas mit Konrad Ludwig Schwab (1780–1859). Zum andern umfasst die These die Annahme, dass Franz Pforr jene Hochzeit literarisch zu einer Doppelhochzeit von Zwillingsschwestern ausgebaut hat. In seiner Erzählung «Buch von Sulamith und Maria» (Annex 16) erscheinen reale Bezüge zur Familie Hottinger, die nicht nur Overbecks Neigung zu Regula, sondern in verklausulierter Form auch die Neigung Pforrs zum Freund Friedrich Overbeck umfassen (S. 49–51).
Seit 1808 bis zum frühen Tod Pforrs im Jahr 1812 beschäftigten sich die beiden Künstler mit einem Gedanken- und Bildpotenzial, das nachweislich vom Thema «Braut» beherrscht war. Im Kontext allegorischer Figuren und christologischer Szenen beflügelten die Gestalten der Hottinger-Schwestern den Maler Friedrich Overbeck lebenslang. Die literarische Verarbeitung und bildhafte Umsetzung des Braut-Themas verweist auf die malerische Entwicklung der beiden Lukasbrüder. Diese wird im Verlauf der Studie durch zahlreiche Belege erhellt, die der religiösen und gesellschaftlichen Welt am Anfang der romantischen Bewegung sprechenden Ausdruck verleihen. Das vom Schwabe-Verlag in gefälliger Form gestaltete Buch ist reich illustriert; 16 der Abbildungen erscheinen nochmals als ganzseitige Farbtafeln in der Buchmitte. Besondere Erwähnung verdienen die beigegebenen Annexe, ein Abdruck der wichtigsten, im Buch zitierten literarischen Quellen. Ein Personenregister erleichtert die Benützung der vorbildlichen Studie. Professor Michael Thimann, Göttingen, nennt sie in seinem Vorwort (S. 11f.) einen «bedeutenden Beitrag zur Erforschung der Romantik».
Zitierweise:
Braun, Patrick: Rezension zu: Thommen, Heinrich: Sulamith und Maria. Beziehungen zwischen Friedrich Overbeck, Franz Pforr und den Schwestern Regula und Lisette Hottinger (Schriften der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts Olten), Basel, 2018. Zuerst erschienen in: Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, Vol. 117, 2023, S. 424-426. Online: https://doi.org/10.24894/2673-3641.00155.